Interview: Vera Bergen
Vorschaubild: Pexels / cottonbro studio
Mit der Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität (WEGM) stellt der Kanton Luzern die Weichen für die Zukunft: Informatik und Wirtschaft & Recht werden Pflichtfächer, neue Schwerpunktfächer erweitern die Auswahl, und selbstständiges Lernen erhält mehr Gewicht. Was sich durch WEGM für Schulen und Lernenden ändert und wie das Projekt umgesetzt wird, erklärt Gabrijela Pejic, Leiterin der Dienststelle Gymnasialbildung.
In Kürze:
- In der Schweiz wird die gymnasiale Maturität nach rund 30 Jahren erneuert. Ziel ist es, die Ausbildung an neue Herausforderungen wie Digitalisierung und Globalisierung anzupassen und den prüfungsfreien Zugang zu Hochschulen und Universitäten zu sichern.
- Informatik und Wirtshaft und Recht werden zu Grundlagenfächern. Zudem können Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus mehr Schwerpunktfächern auswählen.
- Mit der begleiteten Selbstlernzeit (BSZ) lernen die Jugendlichen, eigenständig zu arbeiten und Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen.
- Von den Lehrpersonen verlangt die Reform mehr Teamarbeit, fächerübergreifenden Unterricht und neue Formen des Lernens.
- Erste Klassen starten ab dem Schuljahr 2027/28 unter den neuen Vorgaben, ein Jahr später folgen alle Luzerner Gymnasien.

Gabrijela Pejic, was ist die Gymnasialreform WEGM und welche Ziele werden damit verfolgt?
Die «Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität» (WEGM) ist ein nationales Reformprojekt des Bundes und der kantonalen Erziehungsdirektorinnen- und Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK). Die letzte grosse Reform liegt rund 30 Jahre zurück, seither hat sich unsere Gesellschaft stark verändert. Dazu zählen Entwicklungen wie die Digitalisierung und die Globalisierung. Die WEGM soll die gymnasiale Ausbildung gezielt auf die Anforderungen der Zukunft ausrichten. Dabei sollen auch neuere pädagogische Ausrichtungen wie die Kompetenzorientierung berücksichtigt werden.
Im Zentrum der Reform stehen die Stärkung der beiden Bildungsziele der gymnasialen Maturität, nämlich der allgemeinen Studierfähigkeit und der vertieften Gesellschaftsreife, die Sicherung des prüfungsfreien Zugangs zu Universitäten, ETH und Pädagogischen Hochschulen sowie die Verbesserung der Vergleichbarkeit der Maturitätsabschlüsse auf kantonaler und nationaler Ebene.
Warum ist WEGM wichtig für den Kanton Luzern und seine Gymnasien? Wo sehen Sie persönlich die grössten Chancen dieses Projekts?
Ob klein oder gross, städtisch oder ländlich: Die neun Luzerner Gymnasien haben unterschiedliche Profile und genau diese Vielfalt ist eine ihrer grossen Stärken. Mit WEGM bekommen wir nun die Chance, unsere Gymnasien zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und gleichzeitig bewährte pädagogisch-didaktische Elemente, die an den einzelnen Schulen entwickelt worden sind, weiterzuführen. Die neuen Spielräume wollen wir bewusst nutzen, um eigene Akzente zu setzen und Neues auszuprobieren.
Ein zentrales Ziel der gymnasialen Bildung ist es, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, ihr Fachwissen und ihre Kompetenzen in neuen Situationen anzuwenden. Sie sollen lernen, sich kritisch mit gesellschaftlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen und eigene Lösungsansätze zu entwickeln. Genau hier liegt für mich die grosse Chance der WEGM. Mit interdisziplinärem Unterricht und den neu im Lehrplan verankerten transversalen Themen wie Digitalisierung, Bildung für nachhaltige Entwicklung BNE oder politische Bildung schaffen wir die Voraussetzungen dafür.
Spannend sind auch die neuen Möglichkeiten im Wahlbereich. Sie eröffnen den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten die Chance, ihre persönlichen Schwerpunkte zu setzen und ihre Talente im Hinblick auf die Studien- und Berufswahl zu entwickeln.
So wird das Gymnasium mit WEGM noch stärker zu einem Ort, an dem Wissen nicht nur vermittelt, sondern auch angewandt und reflektiert wird.

Was ändert sich konkret für die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten durch die Reform WEGM?
Die Umsetzung der WEGM läuft im Kanton Luzern in Form eines kantonalen Projekts. Die Eckwerte dafür hat der Regierungsrat im Juli 2025 verabschiedet.
Neu gehören «Informatik» sowie «Wirtschaft und Recht» zu den Grundlagenfächern, zwei Bereiche, die in unserer Gesellschaft und Wissenschaft stark an Bedeutung gewonnen haben. Auch das Angebot an Schwerpunktfächern wird erweitert. Mit «Informatik» sowie «Geschichte und Geografie» eröffnen sich neue Wahlmöglichkeiten im naturwissenschaftlichen sowie im geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich. Bei den Schwerpunktfächern wird künftig noch mehr Wert auf wissenschaftliches Denken und Arbeiten gelegt. Zudem können Schülerinnen und Schüler neben den vier vorgegebenen Maturitätsprüfungsfächern künftig als fünftes Maturitätsprüfungsfach zwischen Biologie, Physik, Geschichte und Philosophie wählen und damit ihre individuellen Interessen und Stärken einbringen.
Eine weitere wichtige Neuerung betrifft die Ergänzungsfächer. Sie werden künftig interdisziplinär und stärker themenorientiert unterrichtet. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet das, dass sie sich vertieft mit Fragestellungen auseinandersetzen, die mehrere Fachperspektiven verbinden, und lernen, verschiedene Sichtweisen miteinander in Beziehung zu setzen.
Von besonderer Bedeutung ist auch die Einführung der begleiteten Selbstlernzeit (BSZ). In diesen Gefässen arbeiten die Schülerinnen und Schüler selbstständig, werden dabei aber von Lehrpersonen begleitet. So lernen sie nicht nur, sich eigenständig Wissen anzueignen, sondern auch ihre Arbeit zu organisieren und Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. Das sind Fähigkeiten, die für ein erfolgreiches Studium und für das spätere Berufsleben unverzichtbar sind.
Gibt es neue Anforderungen für die Lehrpersonen durch WEGM?
Die Lehrpersonen sind der Schlüssel zum Erfolg von WEGM. Mit dem neuen Rahmenlehrplan und den Eckwerten zur kantonalen Umsetzung kommen neue Anforderungen auf sie zu: eine intensivere Zusammenarbeit im Team, eine stärkere Fokussierung des Unterrichts auf die Kompetenzen, welche die Schülerinnen und Schüler erlangen sollen, mehr interdisziplinäres Arbeiten sowie die Erweiterung des didaktischen Repertoires im Rahmen der begleiteten Selbstlernzeit.
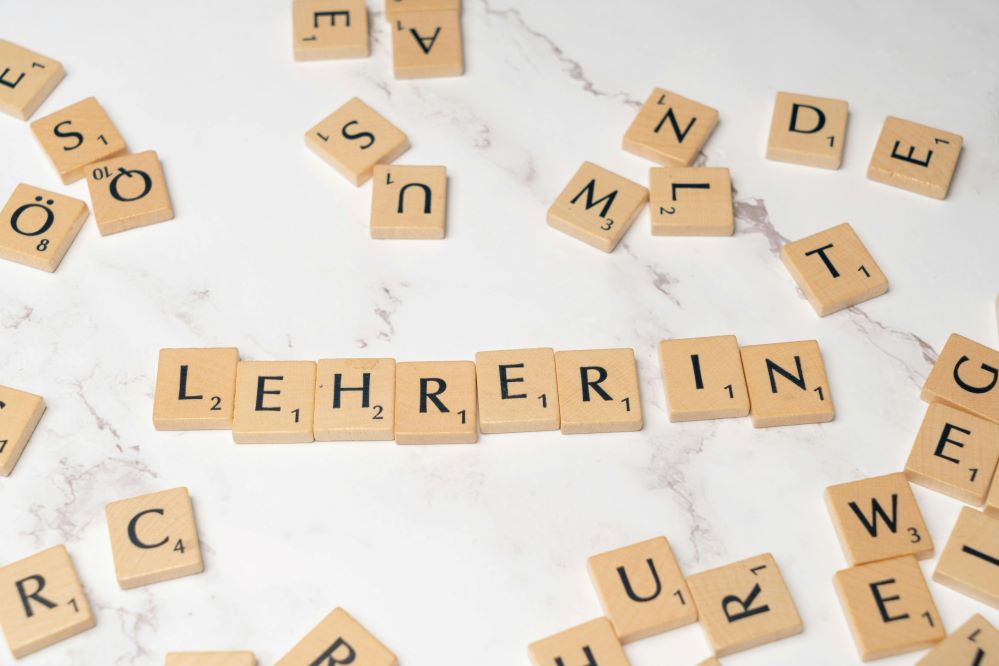
Wie werden die Schulen auf organisatorische Veränderungen, die durch WEGM entstehen, vorbereitet und unterstützt?
Im Kanton Luzern legen wir grossen Wert, die Reformen in einem partizipativen Prozess umzusetzen. Deshalb haben wir die Lehrpersonen von Anfang an eng einbezogen und setzen auch bei der kommenden Lehrplanarbeit auf ihre Fachkompetenz und ihre Erfahrung. Vertreterinnen und Vertreter aller Schulen arbeiten in Lehrplanteams an den kantonalen Lehrplänen mit. Dafür werden zwei Klausuren organisiert, in denen auch der Austausch zwischen den Fachschaften auf einfache Art und Weise möglich wird. Gleichzeitig sorgen wir gemeinsam mit den Schulleitungen dafür, dass die Lehrpersonen in neuen Bereichen durch Weiterbildungsangebote gezielt unterstützt werden, abgestimmt auf ihre konkreten Bedürfnisse und praxisrelevant für den Unterrichtsalltag.
Welche Kosten verursacht WEGM und wie wird die Finanzierung von WEGM langfristig sichergestellt?
Im Endausbau ab dem Schuljahr 2031/32 ist mit jährlichen Mehrkosten von rund 2,2 Millionen Franken zu rechnen. Diese Kosten werden im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans budgetiert.
Ab wann werden erste Ergebnisse oder Veränderungen im Schulalltag sichtbar sein?
Die Talentklassen an den Kantonsschulen Alpenquai und Schüpfheim starten ab Sommer 2027, alle übrigen Klassen ab Sommer 2028 nach dem neuen Reglement. Schon heute setzen die Schulen kleinere Pilotprojekte um, in denen neue Ansätze entwickelt und erprobt werden, etwa interdisziplinäre Projekte oder kürzere BSZ-Sequenzen. Der Wandel ist damit bereits spürbar, die Luzerner Gymnasien sind in Bewegung.

Kommentar schreiben